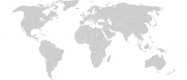
Höhenmedizin - Überblick für Ärzte
Höhenprobleme sind schon immer ein Kernpunkt der Bergmedizin. Höhenmedizinische Forschungen im Alpenraum werden seit mehr als 100 Jahren in hochgelegenen Hütten durchgeführt (Vallot-Hütte im Mont Blanc-Gebiet 1887, Capanna Margherita im Monte Rosa-Gebiet 1893, Jungfraujoch 1912). Heutzutage sind die Möglichkeiten bei weitem vielfältiger als früher. Im Everestgebiet gibt es z.B. auf 5000 m Höhe eine modern eingerichtete Forschungsstation, in Bolivien stand auf dem Gipfel eines Sechstausenders drei Wochen lang ein komplettes Forschungslabor und mit Hilfe von großen Unterdruckkammern wurde bereits zweimal der komplette Aufstieg auf den Mount Everest mit Freiwilligen über einen Zeitraum von etwa sechs Wochen simuliert und analysiert.
Trotz dieser vielen Untersuchungen sind noch lange nicht alle Einzelheiten der Höhenerkrankungen erforscht. Es gibt zwar immer mehr Mosaiksteinchen, aber noch kein fertiges Bild, und manche Studien widersprechen sich sogar, was auf unterschiedliche Studiendesigns, Testpersonen oder Zeitfaktoren zurückzuführen ist. Die heutigen Bergmedizin-Kongresse zeigen aber auch den erreichten hohen Stand bei der höhenmedizinischen Grundlagenforschung. Manche der physiologischen Untersuchungen, wie etwa Hormonbestimmungen, sind mittlerweile so speziell, daß man auch als vorgebildeter Mediziner etwas Mühe hat, alle Details dieser hochwissenschaftlichen Arbeiten zu verstehen. Im folgenden wird jedoch ein kurzgefaßter Überblick für diejenigen Kollegen gegeben, die sich über angewandte Höhenmedizin informieren möchten.
Trekkingtouren und Expeditionen in außereuropäische Gebirge werden heute in einem sehr großen Umfang durchgeführt. Ein Achttausender läßt sich aber trotz aller Fortschritte in Ausrüstung und Knowhow nicht von der Stange kaufen. Das haben besonders die jüngsten Tragödien am Mount Everest gezeigt, die diesen Problembereich auch in das Bewußtsein der Öffentlichkeit gerückt haben. Aus all diesen Gründen gewinnt das ärztliche Wissen um die Anpassung an größere Höhen und die Behandlung von Höhenerkrankungen eine immer stärkere praktische Bedeutung.
Risiko und gesundheitlicher Verlauf beim Höhenbergsteigen
Beim Trekking beträgt der Anteil an gesundheitlichen Zwischenfällen etwa 0,1 %. Die Todesfallrate ist mit 0,01 % relativ gering (15 Fälle auf 100 000 Personen), wobei tödliche Unfälle viermal häufiger vorkommen als Höhenkomplikationen. Das Risiko auf Expeditionen ist deutlich höher: ein Viertel der Teilnehmer erleiden Gesundheitsstörungen. Die Todesrate beträgt etwa 2-3 % und ist damit zweihundertmal größer als beim Trekking. Verantwortlich dafür sind v.a. Unfälle wie Lawinenverschüttung, Absturz, Spaltensturz oder Unterkühlung, die zusammen neunmal häufiger auftreten als reine Höhenerkrankungen wie Lungen- oder Hirnödem. Der höhenbedingte Sauerstoffmangel ist jedoch sicher zu einem großen Teil indirekt an den genannten Unfällen schuld, da er die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit je nach Höhe und Akklimatisationszustand deutlich beeinträchtigen kann, z.B. durch verminderte Beurteilungs- und Reaktionsfähigkeit in Gefahrensituationen. Die Sauerstoffversorgung des Gehirns kann in extremer Höhe durch ungenügende Anpassung deutlich eingeschränkt sein, weshalb es oft zu folgenschwerem Fehlverhalten des Betroffenen kommt.
Trekking beträgt der Anteil an gesundheitlichen Zwischenfällen etwa 0,1 %. Die Todesfallrate ist mit 0,01 % relativ gering (15 Fälle auf 100 000 Personen), wobei tödliche Unfälle viermal häufiger vorkommen als Höhenkomplikationen. Das Risiko auf Expeditionen ist deutlich höher: ein Viertel der Teilnehmer erleiden Gesundheitsstörungen. Die Todesrate beträgt etwa 2-3 % und ist damit zweihundertmal größer als beim Trekking. Verantwortlich dafür sind v.a. Unfälle wie Lawinenverschüttung, Absturz, Spaltensturz oder Unterkühlung, die zusammen neunmal häufiger auftreten als reine Höhenerkrankungen wie Lungen- oder Hirnödem. Der höhenbedingte Sauerstoffmangel ist jedoch sicher zu einem großen Teil indirekt an den genannten Unfällen schuld, da er die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit je nach Höhe und Akklimatisationszustand deutlich beeinträchtigen kann, z.B. durch verminderte Beurteilungs- und Reaktionsfähigkeit in Gefahrensituationen. Die Sauerstoffversorgung des Gehirns kann in extremer Höhe durch ungenügende Anpassung deutlich eingeschränkt sein, weshalb es oft zu folgenschwerem Fehlverhalten des Betroffenen kommt.
Wichtig ist auch, daß man bei Trekkingtouren und Expeditionen einen typischen gesundheitlichen Verlauf beobachten kann: Wenn Probleme auftreten, dann sind es zuerst meist Magen-Darm-Beschwerden durch die Kost- und Klima-Umstellung in fremden Ländern. Nach anfänglichen Akklimatisationsproblemen in der Höhe folgen während der Tour oft Erkältungskrankheiten (wie Rhinitis) und zuletzt meist ein unangenehmer Reizhusten durch die verstärkte Atmung in der kalten, trockenen Höhenluft. Oft zeigt sich am Ende einer Expedition, daß durch Anstrengungen und Höhe sowie wahrscheinlich auch durch (zu) einseitige Verpflegung die Abwehrkräfte allgemein abnehmen. Neben Wundheilungsstörungen kann es daher nach banalen Hautverletzungen auch leichter zu Infektionen oder Abszessen kommen. Ansonsten ist auch das allgemeine Krankheitsrisiko erhöht mit Problemen wie Bronchitis, Pneumonie, Hämorrhoidenbeschwerden sowie Bakterien- oder Parasiteninfektionen.
Probleme bei der Höhenanpassung
Sie werden hervorgerufen durch die Doppelbelastung von körperlicher Tätigkeit mit mehr Sauerstoffbedarf und großer Höhe mit weniger Sauerstoffangebot. Höhenbeschwerden treten in der Adaptationsphase während der ersten Tage fast bei jedem Bergsteiger auf. Dazu zählen leichte Kopfschmerzen, Schlaf- und Appetitstörungen sowie Dyspnoe bei Belastungen, die jedoch alle normalerweise nach wenigen Tagen verschwinden. Die Dauer der Höhenadaptation ist individuell verschieden und abhängig von der Aufstiegsgeschwindigkeit, der absoluten Höhe, dem überwundenen Höhenunterschied und eventuellen Erkrankungen des Einzelnen wie Atemwegsinfekte oder Diarrhoe.
Die Probleme sind natürlich umso geringer, je länger die Akklimatisationszeit ist. Bei älteren Personen scheint sich auch ein guter Trainingszustand positiv auszuwirken. Ansonsten ist eine gute Kondition kein Schutz vor Höhenproblemen, sondern verleitet gerade Jüngere und Höhenunerfahrene dazu, zu schnell aufzusteigen. Migränepatienten leiden häufiger und stärker unter der akuten Höhenkrankheit. Zusammenhänge mit der Größe der Gruppe, dem Rucksackgewicht, Rauch- oder Ernährungsgewohnheiten oder der Einnahme der Antibaby-Pille bestehen nicht. Insbesonders Jüngere unter 20 Jahren (mit einer physiologischen pulmonalen Hypertonie) und Ältere über 50 Jahren (mit evtl. schon verminderter Regulationsfähigkeit) scheinen Höhenprobleme zu bekommen, während im Alter zwischen 30 und 50 Jahren die geringsten Schwierigkeiten auftreten. Besonders wichtig sind frühere höhenbedingte Störungen als Hinweis auf eine erneute Gefährdung. Als kritisch für Höhenanpassungsschwierigkeiten gelten vor allem Trekkingtouren bzw. ein gemeinsamer Anmarsch zum Basislager, da hier meist viele, unterschiedlich reagierende Personen sich an die gleiche Aufstiegsgeschwindigkeit halten müssen und gerade in Höhen zwischen 3000 - 6000 m die meisten Probleme auftreten.
In der Höhe zeigen Bergsteiger nachts oft eine Cheyne-Stoke'sche Atmung. Weiterhin treten gelegentlich Weichteil-Ödeme, meist im Augen- oder Gesichtsbereich oder an Händen bzw. prätibial auf. Auch kann es über 5000 m zu kleinen Retinablutungen kommen. Falls keine weiteren Höhensymptome bestehen, bilden sich diese Veränderungen in allen drei Fällen normalerweise von alleine zurück. In Verbindung mit anderen Beschwerden können sie jedoch auch ein ernstzunehmender Warnhinweis für eine Höhenerkrankung sein.
Akute Höhenkrankheit (acute mountain sickness = AMS)
Die laborchemisch meßbaren Auswirkungen der akuten Höhenkrankheit ähneln sehr denjenigen, die auch bei Training bzw. Belastung in niedrigerer Höhe auftreten, wobei diese Parameter bei Höhenkranken schon vor dem Auftreten von Symptomen feststellbar sind. Im wesentlichen handelt es sich dabei um eine Überlastung bzw. Dekompensation des Organismus auf den auftretenden Sauerstoffmangel.
Die akute Höhenkrankheit kann bei Höhenungewohnten bereits ab 3000 m circa 4 - 24 Stunden nach Erreichen der kritischen Schwelle auftreten, z.B. bei zu schnellem Aufstieg mit einer Seilbahn. In den Alpen wirkt sich dies in der Regel nur selten dramatisch aus, da die Betroffenen wieder schnell ins Tal kommen, wo sich der Zustand meist schlagartig bessert. Aber auch sonst bessert sich die Höhenkrankheit oft spontan, wenn die Betroffenen wegen der Krankheitsfolgen bzw. des Leistungsverlustes freiwillig den Aufstieg unterbrechen oder noch besser absteigen. Beim Höhenlungenödem oder erst recht beim Höhenhirnödem funktioniert jedoch diese Selbstregulation meist nicht mehr, die Erkrankten verdrängen die Symptome oder sind nicht mehr in der Lage, adäquat zu reagieren. Auch deswegen sind diese beiden Formen sehr viel gefährlicher.
Vor der Höhenkrankheit ist niemand geschützt, auch Ausdauertraining zeigt hier keinen prophylaktischen Effekt. Selbst bekannte Achttausenderbergsteiger sind schon höhenkrank geworden, wenn sie sich nicht an die grundlegenden Regeln der Höhenadaptation gehalten haben. Interessanterweise können auch Hochlandbewohner, wie Tibeter, Sherpas oder Indios in den Anden höhenkrank werden, wenn sie sich einige Zeit im Tiefland aufhalten und (zu schnell) wieder in größere Höhen gelangen (Readaptations-AMS). Nur als Kuriosität sei noch erwähnt, daß sogar schon Haustiere, wie etwa Hunde, bei entsprechender Exposition höhenkrank geworden sind.
 Etwa 50% aller Trekker haben oberhalb von 5000 m Höhe Symptome von Höhenkrankheit, wobei Alarmzeichen einzeln oder in Kombination auftreten können. Am häufigsten kommt es zu stärkeren Kopfschmerzen (in ca. 75% und damit Leitsymptom), die sich auch nach einer Schmerztablette (z.B. ASS) nicht unbedingt bessern. Es folgen Tachykardie auch in Ruhe (mehr als 20 Schläge über dem Normalwert), Kurzatmigkeit, Appetit- und Schlaflosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Konzentrations- und Koordinationsstörungen, ungewohnter Leistungsverlust, Selbstüberschätzung oder Reizbarkeit sowie Apathie und eventuell Bewußtseinstrübung (siehe auch Abbildung). Die genannten Symptome können individuell sehr stark variieren.
Etwa 50% aller Trekker haben oberhalb von 5000 m Höhe Symptome von Höhenkrankheit, wobei Alarmzeichen einzeln oder in Kombination auftreten können. Am häufigsten kommt es zu stärkeren Kopfschmerzen (in ca. 75% und damit Leitsymptom), die sich auch nach einer Schmerztablette (z.B. ASS) nicht unbedingt bessern. Es folgen Tachykardie auch in Ruhe (mehr als 20 Schläge über dem Normalwert), Kurzatmigkeit, Appetit- und Schlaflosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Konzentrations- und Koordinationsstörungen, ungewohnter Leistungsverlust, Selbstüberschätzung oder Reizbarkeit sowie Apathie und eventuell Bewußtseinstrübung (siehe auch Abbildung). Die genannten Symptome können individuell sehr stark variieren.
Eine Höhenkrankheit ist viel besser zu vermeiden als zu behandeln. Neben Rast und gesüßten Getränken ist die wichtigste Erste-Hilfe-Maßnahme der Abstieg. Bereits wenige hundert Meter tiefer kann es zu einer deutlichen Besserung kommen. Bei starken Beschwerden ist unbedingt ein rascher Abstieg in tiefere Lagen notwendig, notfalls mit passivem Abtransport des Betroffenen.
In schweren Fällen können auch Sauerstoff und Medikamente als zusätzliche Maßnahmen zur Linderung und Überbrückung gegeben werden, wenn ein Abstieg aus Wetter- oder Geländegründen nicht sofort möglich ist. Es empfiehlt sich nach wie vor, Sauerstoff in Flaschen als medizinische Sicherheitsreserve bei Höhenerkrankungen auf Expeditionen, aber auch bei größeren Trekkingtouren mitzunehmen. Mittlerweile sind hyperbare Kammern (Certec- bzw. Gamov-Bag) eine ausgereifte, kosten- und gewichtsgünstige Alternative geworden, zumindest wenn, wie beim Trekking üblich, die ganze Gruppe beisammenbleibt. Mit dem beim Aufpumpen erreichten Überdruck steht dem Organismus ein erhöhter Sauerstoff-Partialdruck zur Verfügung. Dies entspricht etwa einem Abstieg von 2000 Höhenmetern und ist damit sehr effektiv, zumal Erkrankte notfalls im Sack abtransportiert werden können. Normalerweise reicht jedoch eine intervallmäßige stundenweise Behandlung aus, wobei ein anstrengendes kontinuierliches Nachpumpen zur Frischluftversorgung durchgeführt werden muß. Für Notfälle sollten diese Maßnahmen ebenso wie eine Sauerstoffgabe bereits vor dem Höhenaufenthalt allen Gruppenteilnehmern in der Praxis durch eine entsprechende Übung bekannt sein.
Abschließend noch die wichtigsten Leitsätze zur Höhenkrankheit (nach O. Ölz):
1. Erkenne die Höhenkrankheit! (bei Unwohlsein immer von dieser ausgehen, bis das Gegenteil bewiesen ist!)
2. Steige mit Symptomen niemals weiter auf!
3. Steige auf jeden Fall ab, wenn die Krankheitszeichen schlimmer werden!
 Höhenlungenödem (high altitude pulmonal edema = HAPE)
Höhenlungenödem (high altitude pulmonal edema = HAPE)
Diese Erkrankung - derzeit im Mittelpunkt des Forschungsinteresses - entsteht durch erhöhten Pulmonalarteriendruck bei ungleicher pulmonaler Vasokonstriktion sowie (mechanischen) Störungen der Kapillarmembranen. Extrem hoher Streß führt zu einem "Leck", wenn die Eigenspannung der Membrananteile die auftretenden Kräfte nicht mehr kompensieren kann. Die Kapillarmembran als Schlüsselpunkt des Lungenödems zeigt gerade beim Höhenbergsteiger das grundlegende biologische Dilemma auf: Einerseits soll sie sehr dünn sein, um eine gute Diffusion zu ermöglichen, andererseits soll sie extrem stark sein, was sich jedoch nur schwer gleichzeitig erreichen läßt. Der Pulmonalarteriendruck steigt bei Gesunden physiologischerweise in der Nacht und bei Belastungen an, während er bei Personen, die bereits ein Lungenödem hatten und besonders gefährdet sind, schon in Meereshöhe zu hohe Werte zeigt, d.h. die Lunge ist "steifer". Es muß aber noch zusätzliche Auslösefaktoren geben, wie z.B. infektiöse Ursachen und/oder Belastungen (multifaktorielle Genese). Leider gibt es bis heute in Normalhöhe keine eindeutigen Vorhersagemöglichkeiten für Höhenerkrankungen.
Das Lungenödem weist eine Häufigkeit von 1 - 3 % in den kritischen Höhen über 4000 m auf und ist am Anfang nur schwer erkennbar, weshalb die Symptome leicht unterschätzt werden. Zu einer Verschlechterung kommt es vor allem am zweiten Tag bzw. in der zweiten Nacht nach Erreichen einer neuen Höhe. Diese sehr gefährliche Erkrankung kann sich rapide verschlechtern - oft dauert es nur 24 Stunden bis zur vollen Ausprägung des Krankheitsbildes. Deshalb ist die Vorbeugung so wichtig und auf alle Fälle weit effektiver als eine Notfallbehandlung, zumal es in 25 % zu Todesfällen kommt.
Als Leitsymptom gilt der plötzliche körperliche Leistungsverlust. Zu den häufigsten Warnzeichen zählen neben Dyspnoe auch Husten und Erschöpfung sowie Zyanose, während brodelnde Atmung und rasselnder Husten mit blutig-schaumigem Auswurf meist erst spät auftreten. Oft entwickelt sich auch ein begleitendes Fieber. Risikofaktoren sind ungenügende Akklimatisation bei zu schnellem Aufstieg und Hämokonzentration durch zu geringe Trinkmengen. Vor dem Lungenödem beobachtet man oft Diarrhoe und Erbrechen mit entsprechenden Flüssigkeitsverlusten und geringen Urinmengen, eine Infektion der oberen Luftwege, Erschöpfung nach (Über-) Anstrengungen sowie Inappetenz. Unmittelbar vorher kann es zu Apathie und großem Schlafbedürfnis kommen.
Ohne adäquate Therapie besteht akute Lebensgefahr, deshalb ist eine halbsitzende Lagerung und schnellstmöglicher Abtransport in tiefere Lagen notwendig, wobei wegen des möglichen Zeitverlustes nicht unbedingt auf einen Hubschrauber gewartet werden sollte. Sofern vorhanden, sind zusätzliche Sauerstoffgaben, anfänglich mit ca. 4-6 Liter pro Minute, später mit 2-4 Liter pro Minute und dazwischenliegenden Pausen, Behandlung in einem Überdrucksack sowie Medikamente wie Nifedipin empfehlenswert.
Höhenhirnödem (high altitude cerebral edema = HACE)
Diese Erkrankung tritt meist erst oberhalb 5000 m auf und ist zwar seltener, aber noch gefährlicher als das Lungenödem, da sie in etwa 40 % der Fälle zum Tode führt. Das Nervengewebe reagiert sehr empfindlich auf Sauerstoffmangel. Durch eine veränderte Durchblutung und Wasserverteilung kommt es allmählich zu einer Schwellung und Drucksteigerung im Gehirn. Die Folgen davon sind Koordinationsstörungen wie Gang- und Gleichgewichtsschwankungen. Einfache Tests, um solche Warnsymptome schnell festzustellen, sind z.B. das Gehen im Zehen-Fersen-Gang, d.h. Trippelschritte direkt hintereinander auf einer Linie, evtl. mit geschlossenen Augen..
Weitere Symptome sind Doppeltsehen und psychische Veränderungen wie Halluzinationen oder Apathie bis hin zu Bewußtlosigkeit. Hier können neben schnellstmöglichem Abstieg und Zusatz-Sauerstoff hohe Kortisongaben lebensrettend sein.
Medikamente zur Vorbeugung von Höhenerkrankungen
Medikamente, die in den Mechanismus der Höhenadaptation eingreifen, können eine Höhenkrankheit verschleiern und daher gefährlich werden. Sie erleichtern zwar die Höhenbeschwerden und können im ungünstigste Fall einen scheinbar besseren Akklimatisationszustand und eine falsche Sicherheit vortäuschen! Ähnliches gilt bei bereits eingetretenen Höhenerkrankungen: Die Mittel sind zur unterstützenden Behandlung gut geeignet, ersetzen aber die anderen Maßnahmen, v.a. den Abstieg, nicht! Auch kommt bei einer prophylaktischen Einnahme das ethische Moment des "Doping" ins Spiel.
Zur Vorbeugung von Höhenbeschwerden mit Medikamenten gibt es eindeutige Richtlinien: Tabletten sollten nur dann eingenommen werden, wenn ein schneller Aufstieg unvermeidlich ist (z.B. bei Rettungsaktionen im Hochgebirge oder etwa bei einem Flug nach Lhasa), oder wenn in der Vorgeschichte ein Höhenlungenödem bzw. eine schwere Höhenkrankheit vorgelegen hat.
Diamox (kein eigentliches Notfallmedikament) reguliert den Säurebasenhaushalt in der Niere und verbessert vor allem die in der Höhe eingeschränkte Atmung durch Vertiefung, Beschleunigung und Periodisierung. Durch die höhenbedingte Hyperventilation wird viel Kohlensäure (CO2) abgeatmet und deshalb das Säure-Basen-Gleichgewicht in Richtung einer respiratorischen Alkalose verschoben.
In der medikamentösen Behandlung des Höhenlungenödems hat sich in den letzten Jahren Nifidepin (z.B. Adalat) durchgesetzt. Nifidepin senkt den erhöhten Lungenarteriendruck, wirkt deshalb besonders gut beim Lungenödem und führt zu einem verbesserten Gasaustausch. Zusätzlich zeigt es auch einen meßbaren Nutzen beim Aufstieg von gefährdeten Personen, die schon früher ein Lungenödem hatten, und kann deshalb in diesem Spezialfall als Prophylaxe vor einer erneuten Erkrankung verwendet werden.
Trotzdem empfiehlt es sich - außer im Notfall - generell Medikamente umso zurückhaltender einzusetzen, je höher man steigt, da manche (v.a. Schlafmittel) in extremen Höhen gegenteilige Reaktionen auslösen und die Nebenwirkungen sehr gefährlich werden können. Deshalb sollte gerade eine Medikamentenempfehlung immer individuell erfolgen. Da bei weiteren Forschungen auf diesem Gebiet noch Änderungen zu erwarten sind, werden hier absichtlich keine speziellen Dosierungen der Medikamente angegeben. Als praktische Konsequenz sollte der Höhenbergsteiger zwar Medikamente für den Notfall mit sich führen, die Höhenerkrankungen selbst müssen aber unbedingt durch Vernunft und richtiges Verhalten so weit als möglich verhindert werden!
Literatur
Berghold F., Schaffert W.
Handbuch der Trekking- und Expeditionsmedizin
Praxis der Höhenanpassung - Therapie der Höhenkrankheit
DAV Summit Club, München, 7. Auflage 2009, 136 Seiten
"Für Ärzte sehr zu empfehlen und auf neuestem Stand!"
Erste Hilfe und Gesundheit am Berg und auf Reisen
Alpine Lehrschrift von Dr. Walter Treibel
Bergverlag Rother München, 2. Auflage 2011